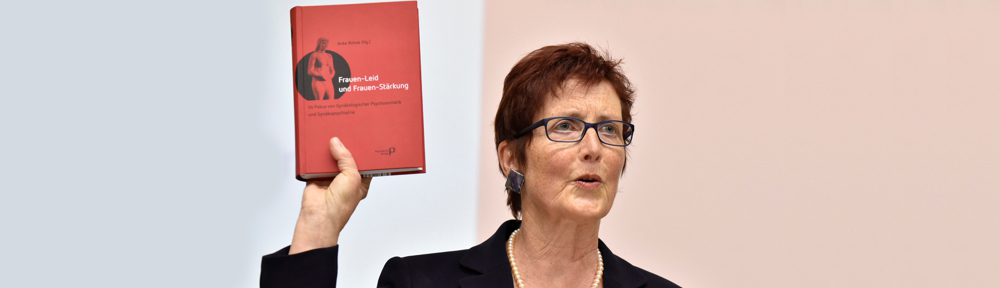Psychische Störungen nach der Entbindung
Eine Information für Betroffene und Angehörige
Häufigkeit
Die nach einer Entbindung auftretenden psychischen Störungen kann man grob in drei Kategorien einteilen:
Der sogenannte Babyblues (»Heultage«) tritt bei 40 bis 70 % aller Frauen in den ersten 3 bis 5 Tagen nach der Entbindung auf. Zentrales Symptom ist eine stimmungsmäßige Labilität (z. B. mit raschem Wechsel von Glücklichsein und Weinen). Dabei handelt es sich um die Folge der raschen Hormonumstellung nach der Entbindung und nicht um eine behandlungsbedürftige Störung.
Seltener sind die sogenannten Wochenbettdepressionen (postnatale oder in der Fachsprache postpartale Depressionen) mit einer Häufigkeit von etwa 1 auf 10 Geburten. Sie treten meist in den ersten Wochen nach der Geburt auf und können i. d. R. ambulant behandelt werden. Übergänge von Wochenbettdepressionen zu den seltenen Wochenbettpsychosen (0,1–0,2 %) mit Wahnsymptomen, Stimmenhören und anderen psychotischen Symptomen kommen vor.
Depressionen
Bei postpartalen Depressionen können vielfältige Symptome auftreten, wie etwa depressive Verstimmung mit häufigem Weinen, Grübeln, Hoffnungslosigkeit, Minderwertigkeits- und Schuldgefühlen, Ängste bis hin zu Panikattacken, Reizbarkeit, innerer Unruhe, Interesselosigkeit, Antriebslosigkeit und Konzentrationsstörungen. Auch Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, Liebe oder Sympathie zu empfinden (oft resultierend in dem Gefühl, dem Kind gegenüber keine richtigen Muttergefühle zu empfinden), sind typisch.
Das körperliche Befinden ist in der Regel ebenfalls gestört, z. B. durch Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Herzbeschwerden, Engegefühl in der Brust, Kloßgefühl im Hals sowie andere körperliche Missempfindungen. Diese körperlichen Symptome können im Vordergrund der Symptomatik stehen und sind nicht immer einfach von den Folgen der Entbindung, der Belastung durch das Kind, das Stillen, den Schlafmangel etc. abzugrenzen.
Sehr quälend ist für die betroffene Mutter das Auftreten von Zwangsgedanken (wiederkehrende unangenehme Gedanken, die von der betroffenen Mutter als unsinnig angesehen werden und die überhaupt nicht zu ihrem eigenen Wertesystem passen). So etwa der Gedanke, dem Baby etwas anzutun, es zu verletzen, es sogar zu töten; manchmal bis hin zu bildlichen Vorstellungen davon. Solche Zwangsgedanken versetzen die Mutter in starke Angst. Sie sieht darin einen Beweis, dass sie eine schlechte Mutter sei und ihr Kind nicht liebe; sie lebt in Angst davor, dass sie eines Tages das Schreckliche umsetzen könnte. Dabei sind die Zwangsgedanken harmlos, da sie nicht in die Tat umgesetzt werden. Sie resultieren häufig aus dem genauen Gegenteil, dem »Überbehüten« des Kindes. Betroffene Mütter sind immer fürsorgliche Mütter, die den Anspruch haben, ihr Kind »vor allem Bösen in dieser Welt« zu schützen. Und dann kommt plötzlich der Gedanke, man selbst könnte dem Kind etwas antun. Nachvollziehbar, dass betroffene Mütter der Überzeugung sind, »die einzige schlechte Mutter« auf der Welt zu sein, und dass sie aus Scham große Schwierigkeiten haben, darüber zu sprechen.
Sehr ernst zu nehmen sind lebensmüde Gedanken bzw. das Symptom Suizidalität, das bei schweren Depressionen auftritt. Falsch verstandene Rücksichtnahme auf die Mutter ist nicht hilfreich, da bei einer schweren Depression die Gefahr der Umsetzung besteht. Manchmal führt kein Weg an der stationären Behandlung vorbei, wenn man nicht riskieren will, dass die Suizidgedanken »erfolgreich« umgesetzt werden.
Bei den sogenannten psychotischen Depressionen nach einer Entbindung kann die Patientin auch wahnhaft (d. h. absolut und unkorrigierbar) davon überzeugt sein, dass sie das Kind nicht richtig versorgt habe, dass sie eine schlechte Mutter sei und dass das Kind dadurch geschädigt werde. Solche Gedanken oder Überzeugungen müssen unbedingt zur psychiatrischen Untersuchung und Behandlung führen. Der Übergang zur Wochenbettpsychose ist fließend. Besonders gefährlich sind akustische Halluzinationen, also z. B. Stimmen, die der Mutter Befehle geben (z. B. dem Kind etwas anzutun), sowie aus der Symptomatik resultierende irrationale Verhaltensweisen.
Beginn
Postpartale Depressionen können direkt in den ersten Tagen nach einer Entbindung auftreten; typisch ist aber die Entwicklung der depressiven Symptome in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt. Am ehesten gefährdet sind erstgebärende Frauen, was darauf zurückzuführen ist, dass beim ersten Kind noch viele Unsicherheiten bestehen und sich der Lebensrhythmus erst einmal vollständig ändert. Gibt es in der Vorgeschichte schon Depressionen oder andere psychische Probleme, ist von einer erhöhten Empfindlichkeit (= Vulnerabilität) auszugehen. Gleiches gilt, wenn in der näheren Familie Depressionen bekannt sind.
Verursachung
Es liegt nahe, die raschen hormonellen Veränderungen nach der Entbindung für auftretende psychische Störungen verantwortlich zu machen. Die intensive Erforschung dieser Thematik konnte aber zeigen, dass die hormonelle Umstellung nach der Geburt nur ein Aspekt in einem sogenannten multifaktoriellen Geschehen ist. Viele Faktoren können neben der schon erwähnten Vorbelastung bei der Entstehung von Depressionen nach der Entbindung eine Rolle spielen: die körperliche Belastung einer Geburt im allgemeinen, evtl. verstärkt durch Kaiserschnitt oder auftretende Infekte, eventuelle Erkrankungen des Kindes, eine schwierige Lebenssituation oder Beziehungsprobleme, die Veränderung der Rolle für die junge Mutter, nämlich von der berufstätigen Frau hin zur Vollzeitmutter, was in der Regel mit großen Veränderungen auch in den sozialen Kontakten verbunden ist. Und schließlich auch die psychischen Anforderungen der neuen Situation, die umso höher sind, je höher die Ansprüche der Frau an sich selbst sind bzw. je mehr sie das Ziel verfolgt, »eine perfekte Mutter zu sein«.
Behandlung
Postpartale Depressionen werden nach wie vor zu selten erkannt und behandelt, oftmals auch deshalb, weil auftretende Beschwerden als normal für eine junge Mutter angesehen werden oder diese sich schämt, über ihre Beschwerden und Ängste zu berichten. In Abhängigkeit von der Symptomatik bietet sich eine psychotherapeutische Behandlung an, eventuell mit Medikamenten kombiniert. Bei schwereren Depressionen ist der Einsatz von Antidepressiva meist unerlässlich und befähigt die betroffene Mutter überhaupt erst, sich auf eine Psychotherapie einzulassen. Möchte die Mutter weiter stillen, kann das Medikament entsprechend gewählt werden. Ziel der psychotherapeutischen Maßnahmen sind die Bewältigung der Krankheitssymptome, Aufklärung über die Erkrankung unter Einbeziehung des Partners, Erlernen des Umgangs mit Symptomen (besonders wichtig beim Auftreten von Ängsten und Zwangsgedanken), aber auch die Einstellung auf die neue Situation in Familie und Beruf. Bei leichten Depressionen können bereits die enge Betreuung durch eine Familienhebamme oder andere entlastende Maßnahmen hilfreich sein.
Bei psychotischen Depressionen bzw. bei Wochenbettpsychosen ist eine stationäre Behandlung unbedingt erforderlich (z. B. wegen des Suizidrisikos), auch wenn die betroffene Mutter selbst keinerlei Krankheitsgefühl hat. Nach Abklingen der psychotischen Symptomatik muss auch in diesen Fällen die Behandlung durch psychotherapeutische Maßnahmen ergänzt werden, da die Betroffenen und ihre Angehörigen oftmals große Schwierigkeiten haben, mit der Erfahrung dieser Erkrankung fertigzuwerden. Hilfreich dabei kann auch der Kontakt zu anderen Betroffenen sein, z. B. im Rahmen von Selbsthilfegruppen. Unter www.schatten-und-licht.de findet sich auch eine Liste mit Behandlungseinrichtungen, wo Mutter und Kind gemeinsam behandelt werden können.
In allen Fällen unbedingt zu empfehlen – und auch im Vorfeld schon als vorbeugende Maßnahme sinnvoll – ist es, Unterstützung aus dem familiären Umfeld und Freundeskreis anzunehmen. Vor allem der Partner kann sehr viel Unterstützung leisten und Sicherheit geben. Deshalb ist es besonders hilfreich, wenn er sich schon im Vorfeld dafür entscheidet, direkt nach der Entbindung Elternzeit zu nehmen, um für seine Frau und seine Familie da zu sein. Väter, die das umsetzen, erleben diese intensive Zeit in den ersten Wochen mit dem neuen Familienmitglied in der Regel als sehr erfüllend. Übrigens können auch Väter nach einer Entbindung an einer Depression erkranken; es gelten für sie alle hier dargestellten Zusammenhänge genauso.
Die traumatisch erlebte Entbindung
Auch wenn die Entbindung objektiv vielleicht gar nicht gefährlich gewesen und nichts Bedrohliches passiert ist, können Frauen diese trotzdem als traumatisch erleben. Im Extremfall (ca. 3 %) entwickelt sich danach die Symptomatik einer »Posttraumatischen Belastungsstörung« (PTBS), wie sie auch sonst nach schlimmen Lebenserfahrungen auftreten kann. Ausgeprägte Schmerzen, das Gefühl von Hilflosigkeit und Kontrollverlust oder auch andere Erfahrungen in der Entbindungssituation werden als so schlimm erlebt, dass sie in der Folgezeit immer wieder wie ein Film vor den Augen ablaufen (»Flashbacks«), sowohl im wachen Zustand als auch in Träumen. Situationen, die an die Geburt erinnern, werden vermieden, wie etwa Krabbelgruppen, Rückbildungsgymnastik oder auch nur das Gespräch über die Geburt. Dabei ist es gerade bei solchen Erfahrungen wichtig, darüber zu sprechen, möglichst auch mit Menschen, die an der Geburt beteiligt waren, damit sich das Ganze nicht zu einem chronischen Problem entwickelt und z. B. zur Vermeidung weiterer Schwangerschaften führt. Bei ausgeprägter und länger als wenige Wochen andauernder Problematik ist psychotherapeutische Hilfe erforderlich. Bei ausgeprägter depressiver Begleitsymptomatik kann auch ein Antidepressivum sinnvoll sein.
Zur traumatisch erlebten Entbindung gibt es ein eigenes Informationsblatt auf dieser homepage (siehe dort)
Weiterführende Informationen
Rohde A (2014) Postnatale Depressionen und andere psychische Probleme: Ein Ratgeber für betroffene Frauen und Angehörige. Kohlhammer, Stuttgart
Bloemeke V (2015) Es war eine schwere Geburt: Wie schmerzliche Erfahrungen heilen. Kösel-Verlag München
»Bundesinitiative Frühe Hilfen« mit Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten rund um die Geburt (www.fruehehilfen.de)
Selbsthilfegruppe »Schatten und Licht e.V. – Krise nach der Geburt« (www.schatten-und-licht.de)
»Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen e.V.«, Informationen für Betroffene (www.zwaenge.de)
Embryotox Berlin, Informationen zur Medikamentengabe in Schwangerschaft und Stillzeit (www.embryotox.de)